Erwartungen der Städte an den Bund und
die Europäische Union
Oliver Mietzsch, Verkehrsreferent, Deutscher Städtetag, Berlin
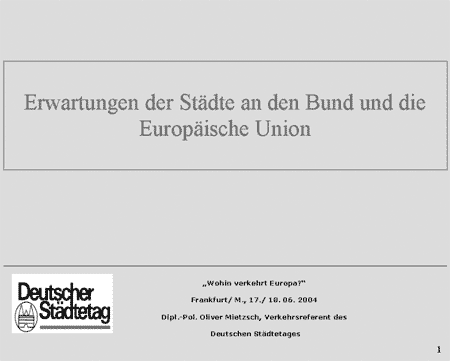
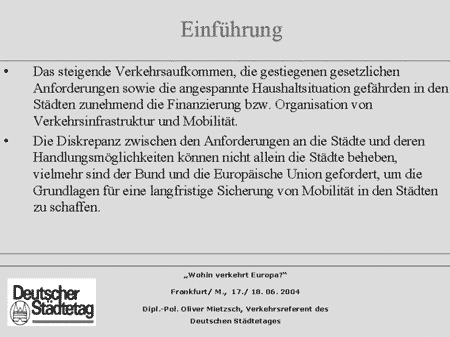
Sehr geehrte Damen und Herren,
die deutschen Städte sehen sich einem zunehmendem Aufkommen des
motorisierten Individual- und Güterverkehrs und somit einem immer
knapper werdendem Verkehrsraum gegenüber. Dem stehen eine immer angespanntere
Finanzsituation und damit einhergehend auch immer geringe Verkehrshaushalte
in den Städten entgegen.
Unter diesen Voraussetzungen haben die Kommunen verkehrs- und umweltpolitische
Aufgaben zu erfüllen, die ihnen von der Europäischen Union gestellt
wurden bzw. in absehbarer Zeit gestellt werden. Dies sind zum Beispiel
die Einhaltung von Grenzwerten bei Luft- und Lärmemissionen.
Hier ist eine deutliche Diskrepanz zwischen den Anforderungen an die Städte
und deren Handlungsmöglichkeiten erkennbar, die bereits mittelfristig
dazu führen könnte, dass entweder den gesetzlichen Anforderungen
nicht Genüge getan werden kann oder komplexe Verkehrssysteme und
die damit verbunden bestmögliche Mobilität für die Bürgerinnen
und Bürger in den Städten nicht mehr zu organisieren sind.
Die Grundlagen zur Sicherung von Mobilität und Verkehrssystemen können
nicht die Städte allein legen. Hier sind vielmehr der Bund und die
Europäische Union gefordert.
2. Erwartungen an den Bund
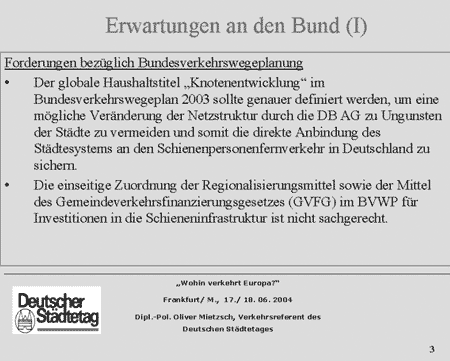
Bezüglich des Bundes enthält vor allem der Bundesverkehrswegeplan
2003 einige Punkte, welche die Bestrebungen der Städte bezüglich
der Senkung des Kraftfahrzeugverkehrs und der Emissionswerte sowie die
Finanzierung für den Erhalt und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur
nicht genügend unterstützen bzw. sogar unterlaufen.
So ist es aus der Sicht der Städte ein gravierender Fehler, dass
bei der Förderung des Schienenwegebaus der globale Haushaltstitel
"Knotenentwicklung" nicht weiter aufgeschlüsselt werden
soll. Dadurch ist es der Deutschen Bahn AG möglich, den Netzausbau
mit Steuermitteln nach eigenem betriebswirtschaftlichem Belieben voranzutreiben
und dabei auch die Netzstruktur zu verändern. Das dies nicht im Interesse
der Bürgerinnen und Bürger der Städte liegt, wird daran
deutlich, das die DB AG zunehmend Mittelzentren, aber auch Oberzentren
mit hohen Umsteigerzahlen (z.B. Frankfurt/ Main und Mannheim) ganz oder
zumindest teilweise vom Hochgeschwindigkeitsnetz abkoppelt. Damit wird
ein zentraler Vorteil der Bahn, nämlich die direkte Anbindung des
breitgefächerten, dezentralen Städtesystems in Deutschland,
aufgegeben und damit die bewährten und gewachsenen Strukturen der
Raumordnung und Landesplanung unterlaufen.
Darüber hinaus sehen die Städte die einseitige Zuordnung der
Regionalisierungsmittel sowie der Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
für Investitionen in die Schienenwegeinfrastruktur zugunsten einer
vermeintlich höheren Gewichtung der Schiene kritisch. Eine solche
Vorgehensweise ist nicht sachgerecht, da bei Einbeziehung der GVFG-Mittel
diese dann analog auch dem kommunalen Straßenbau zugeschlagen werden
müssten. Ähnliches gilt hinsichtlich der Einbeziehung der Regionalisierungsmittel.
Diese Mittel weisen keine Zweckbindung für Investitionen aus, sondern
dienen vorrangig der Bestellung von SPNV - Leistungen. Darüber hinaus
erhalten die Länder die Regionalisierungsmittel für die Übertragung
einer Bundesaufgabe, d.h. sie sind damit Landesmittel. Es ist daher problematisch,
diese Mittel dem Investitionsanteil für die Schiene zuzurechnen,
nur um eine vermeintliche Gleichheit der Höhe der Investitionsmittel
für Straße und Schiene herzustellen.
Gleichwohl begrüßen die Städte grundsätzlich die
angestrebte Gleichbehandlung von Investitionen in die Straßen- und
Schienenwegeinfrastruktur.
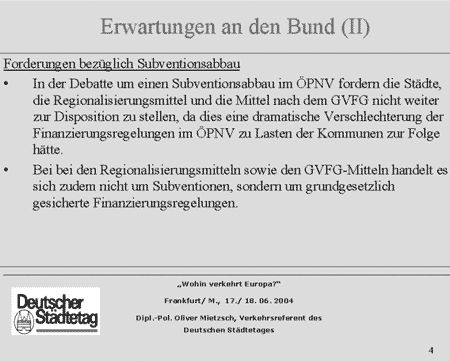
Ebenso sind die Städte grundsätzlich bereit, einen sinnvollen
Subventionsabbau mitzutragen, wie er u. a. von den Ministerpräsidenten
Koch und Steinbrück vorgeschlagen wurde. Wohlgemerkt betreffen die
Vorschläge zum Thema "Subventionsabbau im Konsens" einen
erheblichen Teil der Finanzierungsgrundlagen des öffentlichen Personennahverkehrs.
Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob es sich die Vorschläge
auch wirklich auf Subventionen beziehen und nicht auf Finanzierungsregelungen
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.
Auch hier geht es wiederum im Wesentlichen um die Regionalisierungsmittel
sowie um die Mittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Bei beiden handelt
es sich nach Ansicht der Städte nicht um Subventionen. Vielmehr handelt
es sich um grundgesetzlich gesicherte Finanzierungsregelungen des Bundes.
Im Falle der Regionalisierungsmittel ergibt sich dies vor dem Hintergrund
der Bahnstrukturreform aus dem Jahre 1996 (Art. 87 e GG), in deren Folge
eine Aufgabenverlagerung für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs
vom Bund auf die Länder stattgefunden hat. Die vorgeschlagene Streichung
der Mittel geht jedoch nicht mit der Rückverlagerung der Aufgabe
einher, was dann eigentlich notwendig wäre. Der bestehende Mehrbelastungsausgleich,
den Art 106 a GG festschreibt, wird somit verletzt.
Auch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz betrifft keine Subvention,
sondern die Finanzierungsregelung für die Verkehrsinfrastruktur in
den Gemeinden auf der Grundlage des Art. 104 a (4) GG. Die vorgeschlagene
Rücknahme der GVFG-Mittel träfe insbesondere den kommunalen
Schienenverkehr mit U-Bahnen, Stadt- und Straßenbahn. Der Investitionsbedarf
auch und gerade im Bereich der kommunalen Schieneninfrastruktur hat jedoch
erheblichen Zuwachs und angesichts der dramatischen Situation der kommunalen
Haushalte bestünde für die Kommunen auch keine Möglichkeit,
die Ausfälle der GVFG-Mittel zu kompensieren.
Die Städte legen daher nahe, diese beiden Vorschläge im Rahmen
der Überlegungen zum Subventionsabbau nicht weiter zu verfolgen,
da sie die Finanzierungsregelungen im ÖPNV in unakzeptabler Weise
zu Lasten der Kommunen (und auch Länder) verschlechtern würden.
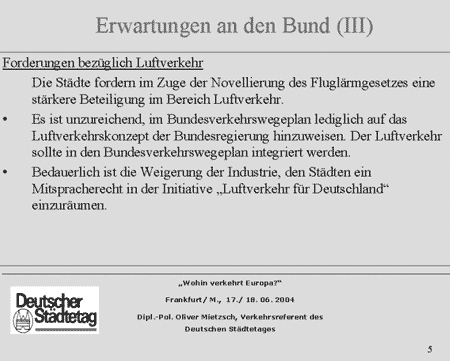
Letztlich ist es aus Sicht der Städte unerlässlich, den Bereich
Luftverkehr in den Bundesverkehrswegeplan 2003 zu integrieren, denn bei
Flugrouten handelt es sich ebenso sehr um Verkehrswege wie bei Straße,
Schiene oder Schiff. Der bloße Verweis auf das Luftverkehrskonzept
der Bundesregierung ist daher nicht ausreichend.
Darüber hinaus ist es notwendig, im Rahmen der Novellierung des Fluglärmgesetzes
die Beteiligung der Städte und Gemeinden an der Festlegung der Flugrouten,
die Gleichbehandlung von Militärflughäfen und Zivilflughäfen
bei der Absenkung der Grenzwerte für die Schutzzonenfestlegung sowie
die Definition von Nachtschutzzonen zu regeln.
Zudem fordern die Städte eine starkes Engagement des Bundes, insbesondere
des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, in der Initiative
"Luftverkehr für Deutschland". Die Städte messen dieser
von der Luftverkehrswirtschaft ins Leben gerufenen Initiative große
Bedeutung zu, da hierbei das Thema Luftverkehr nicht nur unter ökologischen,
sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Stärkung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland diskutiert wird. Umso bedauerlicher ist die Weigerung der
Initiatoren und hier insbesondere der Industrie, den Städten ein
Mitspracherecht einzuräumen.
3. Erwartungen an die Europäische Union
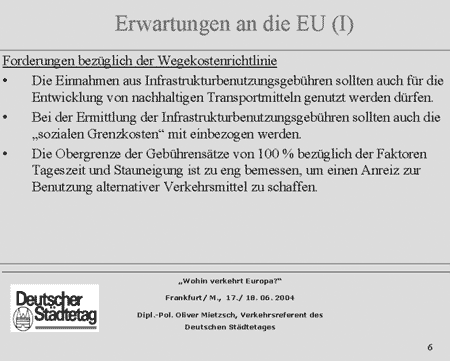
Auf europäischer Ebene ist die aktuelle Debatte zur Änderung
der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für
die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge auch
für die Städte von Brisanz.
Die Kommunen begrüßen prinzipiell den Kommissionsvorschlag,
dessen Ziel es ist, die nationalen Systeme der Mauterhebung bzw. Straßennutzungsgebühren
anzugleichen, um dadurch die Internalisation bestimmter vom Verkehrs verursachter
Kosten zu erleichtern und somit faire Wettbewerbsbedingungen zwischen
den verschiedenen Transportsystemen in der Europäischen Union herzustellen.
Insbesondere begrüßen die Städte, dass Mauteinnahmen bzw.
das Aufkommen aus Straßennutzungsgebühren nicht ausschließlich
für Erhaltungsinvestitionen der Straßeninfrastruktur zu verwenden
sind, sondern dem gesamten Verkehrssystem zu Gute kommen sollen. Der Kommissionsvorschlag
zur Richtlinienänderung sollte jedoch diese Absicht noch deutlicher
zum Ausdruck bringen, in dem es den Mitgliedsstaaten ermöglicht wird,
die Einnahmen für die Entwicklung von nachhaltigen Transportmitteln
verwenden zu dürfen, wie es im übrigen auch im Weißbuch
zur europäischen Verkehrspolitik und in der Nachhaltigkeitsentwicklungsstrategie
der EU vorgesehen ist.
Zum Bedauern der Städte sieht der Kommissionsvorschlag über
die Erhebung von Infrastrukturbenutzungsgebühren hinaus keine Möglichkeiten
vor, die externen Kosten der Verkehrsstaus sowie der von ihnen ausgehenden
negativen Auswirkungen auf die Umwelt bei der Ermittlung der Gebühren
zugrunde zu legen. Denn ein Ansatz, der die "sozialen Grenzkosten"
des Verkehrs, einschließlich der umweltbedingten Kosten einbezieht,
würde die Effizienz und Nachhaltigkeit des Verkehrssystems signifikant
verbessern.
Diesen Ansatz fordert die Europäische Kommission im übrigen
selbst, in ihrem Weißbuch zur europäischen Verkehrspolitik
aus dem Jahr 2001.
Die Städte begrüßen jedoch, dass den Mitgliedsstaaten
die Möglichkeit gegeben werden soll, die Gebührensätze
nach Fahrzeugtypen, Tageszeit, Stauneigung, Bevölkerungsdichte und
ökologischen Gesichtspunkten differenzieren zu können. Die vorgeschlagene
Obergrenze von 100 % für die Faktoren Tageszeit und Stauneigung ist
allerdings zu eng bemessen, um einen wirklichen Anreiz für die Benutzung
alternativer Verkehrsmittel zu schaffen und ist daher nicht kompatibel
mit dem Ziel, den Modal Split zugunsten des öffentlichen Verkehrs
zu erhöhen.
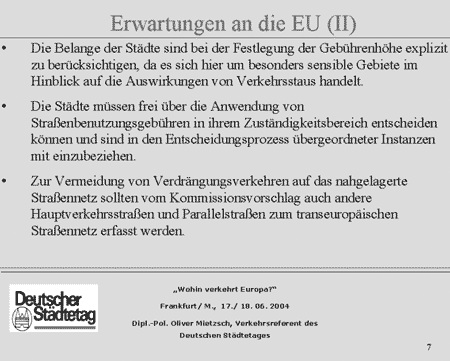
Der Kommissionsvorschlag sieht weiterhin vor, dass den Belangen besonders
sensibler Gebiete bei der Festlegung von Mauthöhe bzw. Infrastrukturnutzungsgebühren
besondere Aufmerksamkeit zukommen muss. Hier ist darauf hinzuweisen, dass
städtische Gebiete explizit im Kommissionsvorschlag berücksichtigt
werden sollten, zumal es an einer Legaldefinition der besonders sensiblen
Gebiete im Richtlinienvorschlag fehlt.
Angesichts der besonderen Belastung städtischer Gebiete mit den Folgen
von Verkehrsstaus wie zum Beispiel Luftverschmutzung und Verkehrslärm
ist es aus Sicht der Städte unerlässlich, das städtische
Gebiete im Kommissionsvorschlag explizit berücksichtigt werden
Grundsätzlich müssen lokale und regionale Gebietskörperschaften (also auch die Städte) frei über die Anwendung von Straßenbenutzungsgebühren in ihrem Zuständigkeitsbereich entscheiden können, insbesondere um somit aktiv auf die Vermeidung von Verkehrsstaus und Umweltbelastungen einwirken zu können. Darüber hinaus sind die Kommunen insbesondere im Hinblick auf mögliche Verlagerungswirkungen auf die Straßen in ihrem Verantwortungsbereich, die durch die einseitige Festlegung von benutzungsgebührenpflichtigen Straßen seitens übergeordneter Instanzen entstehen könnten, aktiv in den Entscheidungsprozess einzubinden. Des weiteren sollten die Mitgliedstaaten die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Kommunen auch bei der Entscheidung über die Verwendung des Gebührenaufkommens berücksichtigen.
Letztlich sollten zur Vermeidung von Verdrängungsverkehren auf das nahgelagerte Straßennetz vom Richtlinienvorschlag der Kommission auch andere Hauptverkehrsstraßen und Parallelstraßen zum transeuropäischen Straßennetz erfasst werden.
4. Fazit
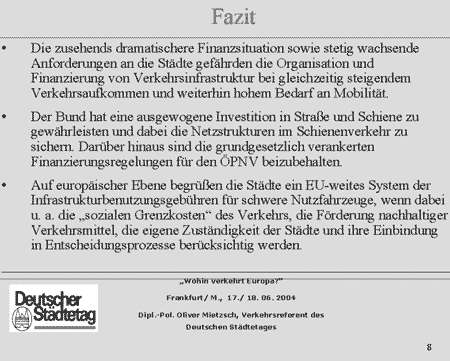
Die zusehends dramatische Finanzsituation sowie die stetig wachsenden Aufgaben der Städte gefährdet die Organisation und Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur bei gleichzeitig steigendem Verkehrsaufkommen und Bedarf an Mobilität der Bürgerinnen und Bürger. Diese "Lücke" zu schließen und gleichzeitig die Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur und Mobilität zu sichern bzw. neue Finanzierungsarten für nachhaltige Verkehre zu schaffen, ist Aufgabe des Bundes und der Europäischen Union.
So hat der Bund eine ausgewogene Investition in den Straßen- und Schienenwegebau zu gewährleisten und dabei insbesondere darauf zu achten, dass Fördermaßnahmen nicht von einzelnen Akteuren dazu genutzt werden können, um Netzstrukturen nach ihrem betriebswirtschaftlichen Kalkül zu verändern. Hier hat der Bund die Pflicht zur Daseinsvorsorge! Des weiteren erwarten die Städte vom Bund die Sicherung der grundgesetzlich verankerten Finanzierungsregelungen für den ÖPNV.
Auf europäischer Ebene begrüßen die Städte prinzipiell
die Schaffung eines EU weiten Systems der Infrastrukturbenutzungsgebühren.
Insbesondere, wenn
- den Städten die Entscheidung hinsichtlich der Anwendung von Benutzungsgebühren
in ihrem Gebiet überlassen wird;
- die Einbeziehung der "sozialen Grenzkosten" des Verkehrs bei
der Festlegung der Gebührenhöhe berücksichtigt wird;
- das Gebührenaufkommen auch für nachhaltige Verkehrsmittel
verwendet werden kann;
- es den Mitgliedsstaaten möglich ist, die Gebührenhöhe
in Abhängigkeit von der Belastung in bestimmten sensiblen Gebieten
zu variieren und
- die kommunalen Behörden aktiv in den Entscheidungsprozess einbezogen
werden.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.