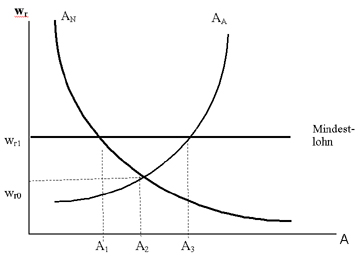
Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland im Sommer 2002 auf über vier
Millionen angestiegen. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von fast 10%,
etwa 8% im Westen und 18% im Osten (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002).
Dazu kommt die verdeckte Arbeitslosigkeit von Ende 2001, rund 1,7 Millionen
Personen (1) .Anlass genug für die Bundesregierung,
sich verstärkt um das Problem der Arbeitslosigkeit zu kümmern. Sie
richtete kurz vor der Bundestagswahl 2002 eine Kommission "Moderne Dienstleistungen
im Arbeitsmarkt" ein nach dem Vorsitzenden "Hartz-Kommission"
genannt. Im August 2002 stellte diese Kommission ihren Bericht vor, der vielfältige
Vorschläge macht und die Arbeitslosigkeit bis 2005 halbieren soll. Die
Bundesregierung hat angekündigt diese Vorschläge zügig umzusetzen.
Auffallend ist, dass die bisherige Diskussion der Hartz-Vorschläge sich
in Einzelheiten verläuft. Die ökonomietheoretischen Unterstellungen
des Hartz-Ansatzes bleiben dagegen weitgehend im Dunkeln. Im vorliegenden Beitrag
soll der implizite theoretische Unterbau des Berichtes beleuchtet und kritisiert
werden.
Arbeitsmärkte sind in allen entwickelten kapitalistischen Ökonomien
durch vielfältige Regulierungen gekennzeichnet, die in ihren Ausmaß
die Regulierungen in anderen Märkten weit übertreffen. Darin kommt
zum Ausdruck, dass Arbeit keine gewöhnliche Ware ist und der Arbeitsmarkt
offensichtlich auch nicht wie ein gewöhnlicher Markt funktioniert. Dies
zeigt sich schon daran, dass der Arbeitsmarkt während der letzten Jahrzehnte
in fast allen Industrieländern durch hohe Arbeitslosigkeit gekennzeichnet
ist. Betrachtet man die historische Entwicklung ab dem 19. Jahrhundert, dann
müssen Phasen von Vollbeschäftigung eher als Ausnahme und gerade nicht
als Regel angesehen werden. Allerdings zeigen die Phasen niedriger Arbeitslosenzahlen,
etwa die 1960er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, dass ein hoher Beschäftigungsstand
unter bestimmten Bedingungen möglich ist.
Üblicherweise wird die intensive Regulierung des Arbeitsmarktes damit begründet,
dass auf dem Arbeitsmarkt Leistungen von Menschen gehandelt werden und dadurch
eine soziale Komponente unumgänglich sei. Das ist richtig, jedoch erweisen
sich viele Regulierungen des Arbeitsmarktes auch jenseits sozialer Aspekte aufgrund
der Funktionsbedingungen marktvermittelter Ökonomien als sinnvoll und wichtig.
So bewirkt die Existenz von Gewerkschaften oder von Institutionalisierungen,
die ein Schwanken der Löhne wie etwa das Schwanken der Ölpreise verhindern,
eine makroökonomische Stabilisierung. Unten wird näher auf dieses
Argument eingegangen.
Die äußerst heterogenen Regulierungen des Arbeitsmarktes können
für unsere Zwecke in folgende Gruppen eingeteilt werden:
- Erstens: Institutionalisierungen zur Bestimmung des Lohnniveaus.
Unter diesen Punkt fallen insbesondere Tarifverhandlungen, die das Lohnniveau
bzw. die Lohnkosten der Unternehmen bestimmen, sowie gesetzliche Bestimmungen
wie Mindestlöhne, die ebenfalls das Lohnniveau beeinflussen können.
Von Relevanz ist hier das Niveau der Bruttolöhne einschließlich der
Arbeitgeberzahlungen an die Sozialkassen. Denn es ist für die Kostenbelastung
eines Unternehmens gleichgültig, wie sich die Lohnkosten aufteilen, ob
der Anteil der Nettolöhne auf Kosten der Sozialabgaben steigt oder umgekehrt.
- Zweitens: Institutionalisierungen zur Bestimmung des Lohnstruktur.
Auch die Lohnstruktur wird durch Tarifverhandlungen und gesetzliche Regelungen
wie beispielsweise gesetzliche Mindestlöhne determiniert. Steuerliche Anreize
oder ähnliche Mechanismen können die Löhne für bestimmte
Arbeitnehmergruppen senken und damit auf die Lohnstruktur einwirken. Veränderungen
der Lohnstruktur wirken in aller Regel auch auf das Lohnniveau.
- Drittens: Institutionalisierungen zur sozialen Absicherung und zum Schutz
von Arbeitnehmern.
Unter diesen Punkt fallen eine Unzahl von gesetzlichen
Bestimmungen wie Kündigungsschutz, Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen,
Jugendschutz, Regulierungen der Unfallverhütung etc. Diese Institutionalisierungen
sind teilweise gesetzlich bestimmt, teilweise ergeben sie sich aus Tarifvertragsregelungen
oder aus unternehmensbezogenen oder individuellen Arbeitsverträgen. Ökonomisch
lassen sich diese Punkte alle auf Kosten reduzieren, die ein Unternehmen zu
tragen hat. So führt beispielsweise ein umfangreicherer Kündigungsschutz,
eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder längerer Urlaub zu höheren
Lohnkosten, während die Streichung eines gesetzlichen Feiertages die Lohnkosten
senkt. Der gesamte Komplex dieser Regulierungen wirkt sowohl auf das Lohnniveau
als auch auf die Lohnstruktur ein. Auf theoretischer Ebene genügt es somit,
die ökonomischen Effekte solcher Regelungen in der Form einer Veränderung
des Lohnniveaus und der Lohnstruktur zu diskutieren, denn alle Veränderungen
in diesem Bereich wirken letztlich auf diese beiden Größen.
- Viertens: Beschleunigung der Arbeitsvermittlung.
Gelingt es, bei Existenz
offener Stellen die Vermittlung von Arbeitslosen zu beschleunigen, dann sinkt
die Arbeitslosenquote. Eine Beschleunigung kann wiederum durch vielfältige
Maßnahmen erreicht werden: Beispielsweise durch ein effizienteres Informationssystem
und eine effizientere Vermittlungsbehörde, durch Qualifikationsmaßnahmen
bei einem unterschiedlichen Profil der offenen Stellen und der Arbeitslosen,
durch Mobilitätsförderung bei einem regionalen Ungleichgewicht von
offenen Stellen und Arbeitslosen oder durch Erhöhung des Zwangs gegenüber
Arbeitslosen, auch Stellen anzunehmen, die eine berufliche und einkommensmäßige
Verschlechterung implizieren.
Vor dem Hintergrund dieser Einteilung ist nun vor allem
(2) zu diskutieren der Zusammenhang von:
- Beschleunigung der Arbeitsvermittlung und Beschäftigung
- Lohnstruktur und Beschäftigung
- Lohnniveau und Beschäftigung
Im nächsten Abschnitt werden die einzelnen Vorschläge der Hartz-Kommission
vorgestellt und jeweils einem dieser drei Punkte zugeordnet.
Die Hartz-Kommission hat dreizehn Module erarbeitet (vgl. Hartz-Bericht 2002), die kurz nach Bereichen gruppiert vorgestellt werden sollen.
Beschleunigung der Arbeitsvermittlung
a) Quick-Vermittlung: Personen müssen dem Arbeitsamt schon zum Zeitpunkt
der Kündigung ihre zukünftige Arbeitslosigkeit melden - anderenfalls
drohen ihnen abhängig von der Verspätung Abschläge vom Arbeitslosengeld.
b) Modifizierung der Zumutbarkeitsregeln: Abhängig von der individuellen
Situation wird die Zumutbarkeit bezüglich Mobilität, Qualität
der Arbeit etc. für die Annahme einer neuen Beschäftigung verschärft.
Wird eine angebotene Stelle nicht angenommen drohen Kürzungen des Arbeitslosengeldes.
Eine Nichtzumutbarkeit ist gegebenenfalls vom Arbeitnehmer zu beweisen.
c) Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in JobCenters:
Das Job-Center wird die Anlaufstelle für Arbeitslosengeld und Sozialhilfe.
Nach dem Auslaufen des Arbeitslosengeldes I kommt das Arbeitslosengeld II zum
Zuge, das die bisherige Arbeitslosenhilfe ersetzt. Das Höhe des Arbeitslosengeldes
II ist - wie die Sozialhilfe - vollständig bedarfsabhängig.
d) Personal-Service-Agenturen (PSA): Dabei handelt es sich um Zeitarbeitsfirmen,
die Arbeitslose einstellen und an Unternehmen, Haushalte etc. "vermieten".
Insbesondere Langzeitarbeitlose bzw. schwer vermittelbare Personen sollen über
PSAs in das Berufsleben zurückgeführt werden, da sich die Unternehmen
die betreffenden Personen erst einmal ohne weitere Verpflichtung "ansehen"
können. Diese Agenturen können vom Arbeitsamt gegründet werden.
Jedoch können auch bestehende oder neue private oder halbstaatliche Zeitarbeitsfirmen
die Funktion der PSAs übernehmen. Die Verschärfung der Zumutbarkeit
zwingt Arbeitslose dazu, in PSAs eine Stelle anzunehmen. Die Entlohnung in den
PSAs wird tarifvertraglich geregelt.
e) Reform der inneren Verwaltungsstruktur der Bundesanstalt für Arbeit:
Das Ziel liegt in der Steigerung der Effizienz der gesamten Institution beispielsweise
durch transparenteres Controlling und effizientere IT-Steuerung.
f) Umbau der Bundesanstalt für Arbeit: Die Arbeitsämter werden zu
JobCenters, welche die Vermittlung der Arbeitslosen effizienter und schneller
als bisher gestalten sollen. Die Landesarbeitsämter werden zu Kompetenz-Zentren,
die eine Vernetzung verschiedener arbeitsmarktpolitischer Aktivitäten herstellen
sollen und den Job-Centers beratend zur Seite stehen.
Finanzielle Anreize mit Wirkung auf die Lohnstruktur und das Lohnniveau
g) Spezielle Förderung von jugendlicher Arbeitslosen: Zur Finanzierung
zusätzlicher Ausbildungsstellen wird ein Ausbildungszeit-Wertpapier von
lokal oder regional or-ganisierten Stiftungen emittiert. Man hofft, dass die
Stiftungen ein Teil der Kosten über Spenden decken können.
h) Mini-Jobs: Die Verdienstgrenze für Mini-Jobs in privaten Haushalten
wird auf 500 Euro im Monat angehoben. Diese unterliegen einer Sozialversicherungspauschale
von 10% (3).
i) Subventionierung der Unternehmen bei Einstellung eines Arbeitslosen: Werden
Arbeitslose eingestellt, dann erhalten kleinere und mittlere Unternehmen nach
Ablauf der Probezeit einen vergünstigten Förderkredit pro eingestellten
Arbeitslosen von maximal 100.000 Euro. Zur Finanzierung wird eine steuerlich
geförderte Anleihe (Job-Floater) von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
emittiert. Jeder Arbeitslose bringt somit in sein neues Unternehmen einen Förderkredit
in Höhe von potentiell 100.000 Euro mit. Die Bonitätsprüfung
übernimmt die Hausbank des betreffenden Unternehmens.
j) Bonussystem für Unternehmen: Unternehmen, die eine positive Beschäftigungsentwicklung
aufweisen und Arbeitsplätze aktiv sichern, erhalten einen Bonus bei der
Arbeitslosenversicherung und müssen geringere Arbeitslosenbeiträge
bezahlen. Es dürfte nicht einfach sein, für ein solches Bonussystem
einen geeignete Indikator zu entwickeln, da die konjunkturelle Entwicklung von
einzelnen Unternehmen nicht gesteuert werden kann und auch branchenabhängig
ist.
Unsystematisches ohne relevante Wirkung auf die Beschäftigung
k) Ausgliederung ältere Arbeitnehmer: Im Rahmen des "Bridge-Systems"
können ältere Arbeitnehmer auf eigenen Wunsch ab 55 Jahren aus der
Arbeitsvermittlung ausgegliedert werden. Sie erhalten statt Arbeitslosengeld
eine kostenneutrale monatliche Leistung. Sie werden aus der Arbeitslosenstatistik
ausgegliedert und gesondert ausgewiesen. Nehmen ältere Arbeitslose eine
niedriger bezahlte Beschäftigung an, dann übernimmt das Arbeitsamt
Teile des Einkommensverlustes für einige Jahre. Obwohl die Gruppe der ausgegliederten
Arbeitslosen transparent in der Statistik ausgewiesen werden soll, liegt der
Verdacht nahe, dass es beim Bridge-System im wesentlichen darum geht die Statistik
zu schönen. Immerhin könnten potentiell über 20% der Arbeitslosen
durch diesen "Trick" aus der Arbeitslosenstatistik herausgenommen
werden.
l) Bündnis für mehr Beschäftigung aller gesellschaftlichen Gruppen
(Politiker, Geistliche, Wissenschaftler, Selbsthilfegruppen, Künstler etc.).
Förderung von Selbständigkeit.
m) Ich-AGs (bei Familienbetrieben Familien-AGs): Bei den Ich-AGs erhalten Arbeitslose,
die sich selbständig machen, für bis zu drei Jahren Subventionen maximal
in Höhe der beim Arbeitsamt bei Arbeitslosigkeit ansonsten anfallenden
Kosten. Während bei den Punkten k) und l) keine Beschäftigungswirkungen
zu sehen sind, kann die Förderung des Weges in die Selbständigkeit
positive Wirkungen zeigen. Wie bei den Mini-Jobs soll auch die Ich-AG die Schwarzarbeit
reduzieren.
Die Hartz-Kommission erwartet bei zügiger Umsetzung der Vorschläge
bis Ende 2005 einen Abbau der Arbeitslosigkeit in Höhe um annähernd
zwei Millionen Personen, also in etwa eine Halbierung der Arbeitslosenquote.
780.000 Personen im Rahmen des Aufbaus der Personal-Service-Agenturen, 500.000
Personen durch Ich-AGs, 450.000 durch Beschleunigung der Vermittlung und 250.000
durch gezielte Betreuung in den JobCenters.
In den Vorschlägen finden sich eine Reihe von Punkten, welche die finanzielle Lage der Arbeitslosen verschlechtern. Neben den Punkten a) und b), die in ihrem Finanz-volumen nicht sehr groß sein dürften, ist hier insbesondere der Punkt c) relevant, die Umstellung der bisherigen Arbeitslosenhilfe auf ein Arbeitslosengeld II. Bisher galt, dass die Arbeitslosenhilfe grundsätzlich 53% des letzten Nettoarbeitsentgeltes entspricht. Modifiziert wurde diese Zahlung durch die Anzahl der Kinder sowie die Einkommens- und Vermögenssituation des Arbeitslosen (4). Das vorgeschlagene Arbeitslosengeld II geht nun vollständig vom Versicherungsprinzip ab und folgt der Logik der Sozialhilfe:
"Das Arbeitslosengeld II ist eine steuerfinanzierte bedürftigkeitsabhängige Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts der arbeitslosen erwerbsfähigen Personen im Anschluss an den Bezug von oder der Nichterfüllung der Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosengeld I." (Hartz-Bericht 2002: 27)
Es ist zu erwarten, dass das Niveau der bisherigen Arbeitslosenhilfe deutlich
abgesenkt wird.
Dieser Punkt bedeutet vor allem eine Verschlechterung für Langzeitarbeitslose,
die damit einem stärkern Zwang unterworfen werden, falls vorhanden, für
sie schlechtere Arbeitsstellen anzunehmen. Die Dauer der Bezahlung des Arbeitslosengeldes
I, dessen Höhe sich aus dem Versicherungsprinzip ergibt und sich nach dem
vergangenen Verdienst der arbeitslos gewordenen Person richtet, wird entsprechend
der Zeiten des Versicherungsverhältnisses sowie des Lebensalters des Arbeitslosen
bestimmt. Die maximale Zahlungsdauer beträgt 32 Monate, die jedoch nur
von wenigen Personen erreicht wird. Für Personen unter 45 Jahren beträgt
die maximale Zahlungsdauer 12 Monate. Bei von annähernd 1,5 Millionen
Langzeitarbeitslosen (5) ergibt sich durch die Absenkung
der Arbeitslosenhilfe auf ein vollständig vom Bedarf abhängiges Arbeitslosengeld
II ein beträchtliches Einsparungspotential, jedoch auch eine beträchtliche
Schlechterstellung der Langzeitarbeitslosen.
Es ist eine politische Entscheidung, welche finanziellen Mittel eine Gesellschaft
für ihre Arbeitslosen aufwendet. Zwei Philosophien treffen hier aufeinander.
Wenn Arbeitslosigkeit als individuelles Versagen der Arbeitslosen angesehen
wird, die zu hohe Löhne fordern oder einfach faul sind, liegt es nahe,
an diese Personen eine bedarfsabhängige und niedrige Zahlung zu leisten,
die gerade zum Überleben reicht. Wird Arbeitslosigkeit dagegen als ein
makroökonomisches Problem erachtet, dann ergibt sich ein anderes Bild.
Dann ist es für eine Gesellschaft "schäbig", wenn sie ihre
Arbeitslosen nicht angemessen finanziert. Dass Langzeitarbeitslose nach einer
gewissen Zeit der Arbeitslosigkeit ihre Qualifikationen (einschließlich
der sozialen Fähigkeiten zu Arbeit) verlieren, wird in der ökonomischen
Literatur seit langem unter dem Stichwort Hysteresis bzw. Siebeffekten diskutiert
(vgl. Blanchard 1987). Nach einer Phase langer und hoher Arbeitslosigkeit bildet
sich mehr oder weniger automatisch ein sogenanntes "Lumpenproletariat"
heraus, dass dann immer schwieriger zu vermitteln ist. Ob die Absenkung der
Transferzahlungen an diesen Teil der Gesellschaft, der sowieso zu den Verlierern
gehört, die soziale Kohärenz einer Gesellschaft erhöht, darf
bezweifelt werden. Möglicherweise sind die Kosten, die sich aus potentiell
höherer Kriminalität, geringeren Entwicklungschancen von Kindern aus
diesem Segment der Gesellschaft etc. ergeben, höher als die Einsparungen
- ganz abgesehen von immateriellen Schäden einer Gesellschaft.
Langzeitarbeitslose können über verschiedene Prinzipien finanziert
werden.
Es kann eine großzügige Zahlung entsprechend des letzten Verdienstes
der arbeitslosen Person bezahlt werden oder es kann ein großzügiger
Pauschalbetrag an die Langzeitarbeitslosen bezahlt werden. Mir erscheint eine
großzügige Pauschalzahlung oder Pauschalzahlung mit ganz wenigen
Kriterien - etwa die Kinderanzahl - sozial und administrativ angebrachter zu
sein.
Die meisten der Vorschläge der Hartz-Kommission führen nicht zu einer
längerfristigen finanziellen Belastung der öffentlichen Haushalte
oder der Arbeitslosenversicherung. Jedoch gibt es bezüglich der Finanzierbarkeit
drei Unwägbarkeiten. Es ist unklar, auf welche Resonanz das Ausbildungszeit-Wertpapier
stößt und ob nicht letztlich staatliche Haushalte die finanziellen
Mittel für die Bekämpfung der Jugendar-beitslosigkeit aufbringen müssen.
Da die Anzahl der Berechtigten quantitativ begrenzt ist, dürften die finanziellen
Belastungen nicht ausufern. Das gleiche gilt auch für den Bonus, den Unternehmen
bei beschäftigungsfreundlicher Politik von der Bundesanstalt für Arbeit
erhalten.
Schwieriger abzuschätzen ist die Subventionierung von kleinen und mittleren
Unternehmen bei der Einstellung eines Arbeitslosen. Da diese Unternehmen die
meisten Arbeitsplätze anbieten und die Subventionen für alle Arbeitslose
gilt, liegen hier finanzielle Risiken, die jedoch begrenzt sind. Im Hartz-Bericht
wird eine Modellrechnung präsentiert: Mit einem Job-Floater - also einem
subventionierten Kredit an ein Unternehmen, das einen Arbeitslosen einstellt
- in Höhe von 100.000 Euro und einer Vergabe für 100.000 Arbeitnehmer
ergäbe sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 10 Mrd. Euro. Es wird
davon ausgegangen, dass jährlich etwa diese Summe anfallen könnte
(vgl. Hartz-Bericht 2002: 33). Um die Zahl der Arbeitslosen über diesen
Weg um eine Million zu reduzieren, müsste immerhin die stattliche Summe
von 100 Mrd. Euro aufgebracht werden. Belastet würden die öffentlichen
Haushalte aber nur in Höhe der Zinssubvention. Beträgt die Subvention
beispielsweise 3%, dann würde die Belastung bei 3 Mrd. Euro liegen.
Das Hauptproblem des Job-Floaters liegt in Mitnahmeeffekten. Der Anreiz dürfte
groß sein, bei jeder Einstellung auf den Förderkredit zurückzugreifen
oder erst Arbeitskräfte zu entlassen, um dann andere wieder einzustellen.
Es gibt weitere problematische Aspekte: Was passiert, wenn ein Unternehmen den
Kredit nicht zurückzahlen kann? Bekommen auch kleinere Unternehmen mit
geringen Sicherheiten solche Kredite? Faktisch steckt hinter dem Job-Floater
eine Zinssubventionierung von Investitionen für solvente Klein- und Mittelbetriebe.
Dagegen spricht zunächst nichts. Fraglich ist jedoch, ob eine solche Zinssubventionierung
pauschal an die Einstellung eines Arbeitslosen gebunden werden sollte.
Es fällt auf, dass das Schwergewicht der Vorschläge auf der Beschleunigung
der Arbeitsvermittlung besteht. Dies soll einerseits durch eine Reorganisation
und Effizienzsteigerung der Bundesanstalt für Arbeit geschehen (beim Hartz-Bericht
die Punkte a, d, e und f), andererseits durch eine Erhöhung des Zwangs
auf Arbeitslose, auch wenig attraktive Arbeitsplätze anzunehmen (Punkte
b und c). Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit soll von 33 auf 22
Wochen reduziert werden.
Um durch eine schnellere Vermittlung die Arbeitslosigkeit senken zu können,
müssen offene Stellen lange nicht besetzt sein. Zwar betrug die Suchzeit
der Unternehmen nach neuen Arbeitskräften im Jahre 2001 in Westdeutschland
durchschnittlich 76 Tage und in Ostdeutschland 64 Tage. Da Unternehmen zum frühestmöglichen
Zeitpunkt auf Bewerbersuche gehen, ist die tatsächliche Nichtbesetzung
(Vakanzzeit) eines Arbeitsplatzes jedoch deutlich niedriger. Sie beträgt
im Westen 27 Tage und im Osten 14 Tage (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002).
Sicherlich kann die Vakanzzeit verkürzt werden. Es kann jedoch ausgeschlossen
werden, dass sich über diesen Effekt eine deutliche Erhöhung der Beschäftigung
ergibt.
Um Stellen vermitteln zu können, müssen Stellen vorhanden sein. Nach
einer Repräsentativ-Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
lag der gesamtwirtschaftliche Bestand offener Stellen bei 1,16 Millionen. Etwa
37% der freien Stellen wurden im Westen den Arbeitsämtern gemeldet, im
Osten 44% (vgl. Bundesanstalt für Arbeit 2002). Bei offiziell ca. vier
Millionen Arbeitslosen gibt es schlicht und einfach nicht genügend Arbeitsplätze,
die besetzt werden könnten! Dies ist das Kernproblem, das auch die beste
und effizienteste Vermittlung nicht lösen kann.
Vor diesem Hintergrund müssen auch die geschätzten Beschäftigungsmöglichkeiten
bei den Personal-Service-Agenturen in Höhe von 780.000 Personen angezweifelt
werden. Gibt es keine zusätzliche Nachfrage nach Arbeit, dann können
Zeitarbeitsfirmen auch keine zusätzliche Arbeit schaffen. Im Zweifel verdrängen
sie private Arbeitsplätze. Im Interesse schwer vermittelbarer Personen
mögen staatlich geschaffene und tariflich abgesicherte Zeitarbeitsfirmen
dennoch sinnvoll sein, das Arbeitslosenproblem können sie jedoch nicht
lösen.
Existenzgründungen auf kleinster Ebene werden bei der Ich-AG und Investitionen
in Klein- und Mittelbetrieben durch den Job-Floater finanziell unterstützt.
Die Nachfrage nach persönlichen Dienstleistungen im Haushaltssektor wird
durch steuerliche Anreize zu erhöhen versucht. Aber auch in diesen Bereichen
sind die zu erwartenden Beschäftigungseffekte gering. Denn persönliche
Dienstleistungen in Haushalten sind schon jetzt in Form von Schwarzarbeit verbreitet.
Durch steuerliche Anreize kann der Anteil der Schwarzarbeit reduziert werden.
Neue Beschäftigung entsteht dadurch jedoch nicht. Dazu kommt, dass sich
die Nachfrage nach privaten Dienstleistungen und Produkten der Ich-AGs zu einem
großen Teil im Schlepptau der generellen ökonomischen Entwicklung
befindet. Denn persönliche Dienstleistungen etc. werden dann besonders
nachgefragt, wenn die Einkommen der Mittelschichten kräftig steigen. In
konjunkturell schwierigen Zeiten ist die Zinselastizität der Investitionen
gering. Aus diesem Grunde wird auch der Job-Floater in seiner Wirkung begrenzt
bleiben.
Insgesamt lässt das Hartz-Konzept geringe Beschäftigungseffekte erwarten.
Die Annahme einer Halbierung der Arbeitslosigkeit bis zum Jahre 2005 aufgrund
der geplanten Reformen erscheint maßlos überzogen.
Dass eine Beschleunigung der Vermittlung der Arbeitslosen - wenn es unbesetzte
Stellen gibt - die Arbeitslosigkeit einmalig senken kann, ist trivial und braucht
nicht diskutiert zu werden. Hinter dem Hartz-Ansatz steckten jedoch spezifische
ökonomietheoretische Vorstellungen, die auf dem neoklassischen Paradigma
basieren und vom ökonomischen Mainstream vertreten werden. Kernpunkte dieser
Vorstellungen sind, dass Deregulierungen auf dem Arbeitsmarkt in der Form einer
flexibleren Lohnstruktur und eines nach unten beweglichen Lohnniveaus die Beschäftigung
erhöhen. Es wird unterstellt, dass flexible Löhne unmittelbar Vollbeschäftigung
erzeugen könnten. Die Philosophie der Hartz-Vorschläge entspricht
diesen simplen Vorstellungen des neoklassischen Paradigmas.
Daher muss zunächst
etwas grundsätzlicher auf die neoklassische Argumentation bezüglich
Lohnstruktur und Lohnniveau eingegangen werden.
Der Hartz-Bericht beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen, die auf die Lohnstruktur
Einfluss haben. Ei-nerseits werden die Zahlungen an Langzeitarbeitslose gekürzt
und die Zumutbarkeitsregeln verschärft (Punkte b und c), was zu einer weiteren
Spreizung der Löhne in Richtung schlecht bezahlter Arbeit führt. Denn
diese Zahlungen fungieren als eine Art Mindestlohn, da die Entlohnung für
Arbeit nicht unter den Transferleistungen des Staates liegen kann. Andererseits
werden finanzielle Anreize für bestimmte Personengruppen angeboten (Punkte
g, i und j). Dienstleistungen in Privathaushalten werden attraktiver gemacht
(Punkt h).
In der Lohnstruktur gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Dimensionen - regionale
Differenzierung, Differenzierung zwischen Berufsgruppen, Differenzierung zwischen
Branchen etc. Die Hartz-Vorschläge bewirken insbesondere eine größere
Spreizung zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Arbeiten, die eine geringe Qualifikation
benötigen, werden dann im Vergleich zu anderen Arbeiten niedriger bezahlt.
Dieser Punkt wird in diesem Abschnitt diskutiert.
Um die Wirkungen einer verstärkten Lohnspreizung zu diskutieren, gehen
wir modelltheoretisch von einer Ökonomie aus, in der die Profitrate in
allen Branchen gleich ist und Löhne nach unterschiedlichen Berufsgruppen
differenziert sind: Personen innerhalb einer Berufsgruppe sollen aber die gleiche
Entlohnung erhalten. Es gibt also Hilfsarbeiter, die relativ wenig verdienen,
Facharbeiter, die mehr verdienen, und Führungskräfte, die relativ
viel verdienen. Die Unternehmen in unserer Modellökonomie sind durch Vorleistungen
verflochten. Jedes Unternehmen produziert Waren, die zumindest teilweise wieder
in den Produktionsprozess anderer Unternehmen eingehen. Das typische Unternehmen
ist ein Automobilproduzent oder ein Energieunternehmen, das seine Produkte an
andere Unternehmen und an private Haushalte liefert. Auch ein Stahlproduzent,
der ausschließlich an andere Unternehmen liefert, passt ins Bild. Wir
haben somit eine Ökonomie, in der Waren vermittels anderer Waren produziert
werden - sprich eine typische kapitalistische Ökonomie. Unternehmen in
einer derartigen Ökonomie wählen aus dem existierenden Bestand an
Technologien die Technologie aus, die ihren Gewinn maximiert. In die Entscheidung
gehen die Kosten der verschiedenen Vorleistungen ein sowie die Kosten für
Löhne und Zinszahlungen (6).
Was passiert nun, wenn sich in einem solchen Modell die Lohnstruktur in Richtung
einer Absenkung der Löhne für Hilfsarbeiter verändert? Zunächst
werden unterschiedliche Branchen je nach ihrer Beschäftigungsstruktur unterschiedlich
betroffen. Branchen, die viele Hilfsarbeiter beschäftigen, erhöhen
bei unveränderten Preisen ihre Gewinne, Branchen, die keine Hilfsarbeiter
beschäftigen, profitieren von der stärkeren Lohnspreizung überhaupt
nicht. Da wir zudem annehmen, dass der Konkurrenzmechanismus in der Ökonomie
funktioniert, werden die Preise in den Branchen, die von der stärkeren
Lohnspreizung relativ stark profitieren, relativ sinken. Als Resultat ergibt
sich, dass die gesamte Preisstruktur - die Struktur der relativen Preise - in
Bewegung gerät. Es bleibt jedoch nicht bei dem primären Effekt. Da
die produzierten Waren der einen Branche als Vorleistungen der anderen Branche
dienen, kommt es zu einem sekundären Effekt. Denn nun haben sich die Preise
der Vorleis-tungen für die Unternehmen geändert, die darauf mit der
Anpassung ihrer Verkaufspreise reagieren. Es folgt ein tertiärer Effekt
etc. Verändern sich die relativen Preise, dann werden die Unternehmen entsprechend
ihres Profitmaximierungskalküls eine neue Technologie wählen, die
bei gleichem Produktionsvolumen mit einem veränderten Beschäftigungsvolumen
verbunden ist. Bis sich ein neues System relativer Preise ergibt, bei dem die
Profitrate in allen Branchen wieder den gleichen Wert angenommen hat, hat sich
das System relativer Preise und die Technologie in der Ökonomie grundlegend
verändert. Das Problem ist nur: Wie wissen nicht wie. Wir wissen nicht,
ob bei gleichem Produktionsvolumen die Beschäftigung trotz steigender Lohnspreizung
gestiegen ist oder nicht, eine allgemeingültige Aussage ist nicht möglich.
In einer über Waren verflochtenen Ökonomie kann zwischen Lohnstruktur
und Beschäftigung keine eindeutige Beziehung gezogen
werden (7).
Modifizieren wir nun unser bisheriges Modell und bauen "Einbahnindustrien"
ein. Dies sind Industrien, deren Produkte ausschließlich an den Endverbraucher
verkauft werden, die also nicht in einen anderen Produktionsprozess eingehen.
Typische Beispiele für diese Industrien sind Dienstleistungen in Privathaushalten,
große Teile der Tourismusindustrie, Sonnenstudios, Lieferdienste, Privatkliniken
etc. Wenn in diesen Branchen die Lohnkosten sinken, dann werden die Produkte
dieser Branchen billiger. In diesem Fall ist bei einer normalen Reaktion der
Nachfrage mit einer höheren mengenmäßigen Nachfrage nach diesen
Produkten zu rechnen. Dadurch steigt die Beschäftigung in den betreffenden
Industrien an.
Der gesamtgesellschaftliche Beschäftigungseffekt einer stärkeren Lohnspreizung
in der Form der Schaffung gering bezahlter Arbeitsplätze hängt daher
von einer Reihe von Faktoren ab. Zunächst werden nur die Einbahnindustrien
betroffen, die niedrig bezahlte Arbeit einsetzten. Die Kosten und Preise von
privaten Sprachschulen mit hochqualifiziertem Personal werden somit wenig oder
nicht im Preis sinken, während einfache Reinigungsdienstleistungen in Haushalten
deutlich billiger werden.
Je arbeitsintensiver die Einbahnindustrie ist, desto stärker ist der Effekt
einer Lohnsenkung. Die Kosten des Betreibens von kapitalintensiven Salons mit
Spielautomaten werden also von Lohnkosten weniger stark tangiert als die Kosten
der kommerziellen Kinderbetreuung.
Je elastischer die Nachfrage nach Gütern von Einbahnindustrien ist, desto
stärker ist der Beschäftigungseffekt. Elastizitäten hängen
vom Verhalten der Wirtschaftssubjekte ab. Verhalten ist wiederum historisch
spezifisch bestimmt und kann in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.
Es ist somit nicht nur eine Frage des Preises, ob die Nachfrage nach Dienstmädchen
in Haushalten bei sinkenden Löhnen von Dienstmädchen deutlich steigt.
Schließlich reduziert die Verlagerung der Nachfrage der Haushalte hin
zu den billiger werdenden Produkten der Einbahnindustrien die Nachfrage nach
den Produkten anderen Industrien. Ist die Arbeitsproduktivität in beiden
Bereichen identisch, ergeben sich netto keine Beschäftigungseffekte. Beschäftigungseffekte
tauchen somit netto nur auf, wenn die Arbeitsproduktivität in der Einbahnindustrie
relativ gering ist.
Es ergibt sich als Resultat, dass Beschäftigungseffekte einer stärkeren
Lohnspreizung nur bei Einbahnindustrien, die durch geringe Kapitalintensität
und geringe Arbeitsproduktivität gekennzeichnet sind auftauchen. Für
Beschäftigungseffekte bei stärkerer Lohnspreizung in Frage kommen
also insbesondere niedrig bezahlte Arbeitsplätze mit niedrigen Qualifikationsanforderungen
in Privathaushalten und arbeitsintensiven Konsumgüterindustrien (Vgl. dazu
auch Flassbeck/Spieker 2001). Es ist somit kein Zufall, dass im Hartz-Bericht
im Rahmen der Mini-Jobs persönliche Dienstleistungen in privaten Haushalte
für die Arbeitgeber attraktiver gemacht wurden. Die gleiche Stoßrichtung
hat auch die Förderung von Ich-AGs bzw. Familien-AGs. Ein weiterer Effekt
ist zu berücksichtigen. Sinken die Löhne der unteren Lohngruppen und
kommt es zu einer höheren Nachfrage nach Arbeitskräften in diesem
Segment, dann sinkt die Arbeitslosigkeit nur, wenn sich nicht auch das Angebot
an Arbeit erhöht. Dies ist jedoch keinesfalls garantiert, denn der "Armutseffekt"
der sinkenden Löhne kann dazu führen, dass das Arbeitsangebot kräftig
ansteigt und die Arbeitslosigkeit dann nicht sinkt (vgl. dazu die Diskussion
im nächsten Abschnitt).
Die Vorschläge der Hartz-Kommission gehen vielen nicht weit genug. Unterstützt
von der neoklassischen Sichtweise der Welt wird eine generelle Absenkung des
Lohnniveaus gefordert. Niedrigere Löhne, so das Argument, würden die
Nachfrage nach Arbeit erhöhen. Nun wird im Hartz-Bericht keine generelle
Senkung des Lohnniveaus gefordert. Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden,
dass eine Ausfransung der Lohnstruktur nach unten das Lohnniveau insgesamt absenkt.
Zudem soll nach dem Hartz-Bericht Arbeit in verschiedenen Formen subventioniert
werden. Es wird davon ausgegangen, dass solche Subventionen nicht nur die Arbeitslosigkeit
neu verteilen, sondern auch senken. Es schwingt zumindest mit, dass die Senkung
des Lohnniveaus Arbeit schaffen könnte (8).
Beschäftigungseffekte durch relative Verbilligung des Faktors Arbeit im
Vergleich zu Kapital werden von der Bundesregierung auch bei anderen Programmen
erhofft. Zumindest ist das Projekt der Ökosteuer - so sinnvoll es aus ökologischen
Gründen auch sein mag - mit der Kopplung der Senkung der Lohnnebenkosten
von diesem Geist beseelt (vgl. Heine/Herr 1999).
In diesem Abschnitt sollen die Effekte von Lohnsenkungen beleuchtet werden (vgl.
Herr 2002). Dabei folgen wir zunächst dem neoklassische Ansatz und diskutieren,
zu welchen Ergebnissen dieser kommt, so man ihn ernst nimmt. Zu diesem Zweck
sei zunächst ein typisch "neoklassischer" Arbeitsmarkt angenommen,
bei dem Angebot und Nachfrage nach Arbeit nur vom Reallohnsatz abhängt.
Mit steigendem Reallohn pro Stunde bieten nutzenmaximierende Haushalte mehr
Arbeit an, so dass mit steigendem Reallohnsatz das Angebot an Arbeit (AA) steigt.
Die Arbeiter steigen in diesem Fall aufgrund des Anreizes höherer Löhne
von Freizeit auf Arbeit um. Die aggregierte Nachfrage nach Arbeit (AN) hängt
ebenfalls vom Reallohnsatz ab, wobei mit sinkenden Reallöhnen die Unternehmen
mehr Arbeit einsetzen (vgl. Abbildung 1) (9).
Wenn in Abbildung 1 der Reallohnsatz wr1 beträgt, dann fragen die Unternehmen
die Arbeitsmenge A1 nach, was bei weitem nicht dem Arbeitsangebot bei diesem
Reallohnsatz entspricht. Es existiert Arbeitslosigkeit in Höhe von A3 minus
A1. Der Reallohnsatz wr1 liegt über seinem Gleichgewichtsniveau, was insbesondere
durch vermachtete Märkte (Lohnverhandlungen zwischen Gewerkschaften und
Ar-beitgeberverbänden) bedingt sein kann. Die in den Gewerkschaften organisierten
"Insider" verweigern sich Lohnsenkungen, da sie aus egoistischen Gründen
nicht auf die "Outsider" - Arbeitslose - Rücksicht nehmen, die
bei niedrigen Reallohnsätzen Arbeit finden würden. Lohnrigiditäten
können auch durch gesetzliche Mindestlöhne oder zu hohe Sozialtransfers
in der Form von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld be-dingt sein. All diese Faktoren
können, so das Argument, einen funktionswidrigen Mindestlohn etablieren
- wie in der Abbildung 1 eingezeichnet - und dadurch Arbeitslosigkeit zementieren.
Wird der Arbeitsmarkt in dem Sinne flexibilisiert, dass der als dysfunktional
erachtete Mindestlohn beseitigt wird, dann kommt es auf dem Arbeitsmarkt zu
einer Unterbietungskonkurrenz, der die Löhne senkt. Der Reallohnsatz pendelt
sich auf sein Gleichgewichtsniveau (wr0) mit der Beschäftigungsmenge A2
ein. Bei diesem Lohn ist Vollbeschäftigung erreicht, da jeder Arbeitnehmer,
der zu diesem Lohn arbeiten will, einen Arbeitsplatz erhalten kann. Natürlich
kann es freiwillige Arbeitslosigkeit geben, jedoch drückt diese ausschließlich
eine hohe Präferenz der Wirtschaftssubjekte für Freizeit aus.
Abbildung 1: Neoklassischer Arbeitsmarkt in der Standardtheorie
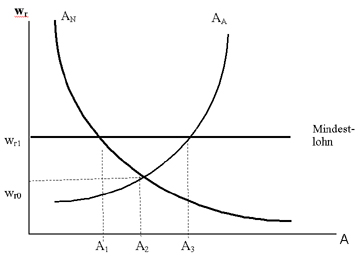
Abbildung 2: Neoklassischer Arbeitsmarkt bei komplizierterer Arbeitsangebotsfunktion
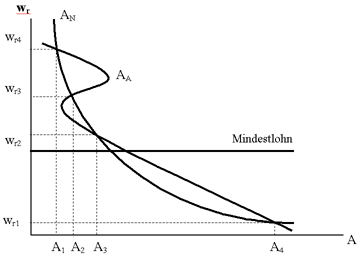
Sowohl die Angebotsfunktion als auch die Nachfragefunktion in der Abbildung
1 sind auf methodisch weichem Grund gebaut. Beginnen wir mit der Angebotsfunktion.
Diese ist keineswegs aus dem neoklassischen mikroökonomischen Kalkül
der Wirtschaftssubjekte ableitbar (10).Wirtschaftssubjekte
können - nach den eigenen Annahmen des neoklassischen Ansatzes - bei Lohnerhöhungen
ihre Arbeit auch einschränken. Dies wird dann auftreten, wenn sie bei hohem
und steigendem Einkommen dem Gut Freizeit einen hohen Wert bemessen (Freizeiteffekt).
Auch ist völlig offen, ob Wirtschaftssubjekte bei fallenden Reallohnsätzen
weniger arbeiten. Haben sie nämlich feste Verpflichtungen, wie beispielsweise
die Abzahlung von Krediten für Haus und Auto oder Ausgaben aufgrund der
Existenz von Kindern, dann werden sie bei sinkenden Löhnen mehr Arbeit
anbieten und nicht weniger (Armutseffekt). Nähern sich die Löhne dem
Existenzminimum, dann wird aufgrund des Armutseffektes jede weitere Lohnsenkung
mehr oder weniger automatisch zur Zunahme des Arbeitsangebots führen. Dieser
Effekt ist aus vielen Entwicklungsländern bekannt, jedoch auch aus Industrieländern,
die durch ein Segment mit relativ sehr niedrigen Löhnen charakterisiert
sind. In diesem Segment nehmen die Menschen häufig zwei oder mehr Arbeitsstellen
an, um ihre Konsumwünsche, die kulturell bestimmt sind, einigermaßen
befriedigen zu können.
In Abbildung 2 ist der Arbeitsmarkt mit einer Arbeitsangebotsfunktion dargestellt,
die plausibel ist. Bei niedrigen Reallöhnen steigt bei sinkenden Reallohnsätzen
das Arbeitsangebot aufgrund des Armutseffektes, während bei hohen Reallöhnen
das Arbeitsangebot bei steigenden Reallohnsätzen aufgrund des Freizeiteffektes
sinkt. In dem angegebenen Fall gibt es vier Gleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt,
die mit unterschiedlichen Reallohnsätzen und Beschäftigungsniveaus
einhergehen (11). Aus Sicht der Arbeitnehmer dürfte
das Gleichgewicht mit dem niedrigsten Reallohnsatz und dem größten
Beschäftigungsvolumen das ungünstigste sein. Denn bei diesem Gleichgewicht
muss für niedrige Löhne sehr viel gearbeitet
werden (12). Gehen wir von einer Ungleichgewichtssituation
aus, die durch einen Reallohnsatz entsprechend des eingezeichneten Mindestlohns
charakterisiert ist. Letzterer mag für Lohnrigiditäten stehen, die
durch Tarifverhandlungen, Transferzahlungen, gesetzlich Mindestlöhne etc.
entstehen. Bei diesem Mindestlohn ist das Arbeitsangebot größer als
die Arbeitsnachfrage. Ohne die Existenz der Lohnrigidität würden aufgrund
des Angebotsüberhangs die Löhne zu sinken beginnen. Unterstellen wir
nun, der Mindestlohn wird durch Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt abgeschafft.
Was passiert? Die Löhne werden sinken und die Ökonomie bewegt sich
in Richtung des "schlechten" Gleichgewichts mit sehr niedrigen Reallöhnen
und großem Arbeitsvolumen. Soll ein solches "schlechtes" Gleichgewicht
verhindert werden, dann sind selbst im neoklassischen Paradigma Mindestlöhne
sinnvoll (13). Funktional wäre
in der beschriebenen Konstellation eine Erhöhung der Mindestlöhne
auf den Reallohnsatz war in Abbildung 2. In diesem Fall könnte eines der
"guten" Gleichgewichte erreicht werden.
Kommen wir nun zur Arbeitsnachfragefunktion. Aus der Logik eines einzelnen Betriebes
erscheint es klar, dass bei sinkenden Löhnen mehr Arbeiter eingestellt
werden. Denn sinken die Löhne bei einem Unternehmen und bei allen anderen
nicht, dann hat das betroffene Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und kann
auf Kosten anderer Unternehmen expandieren. Ob aus einer volkswirtschaftlichen
Sicht ein Sinken der Löhne zu einer höheren Nachfrage nach Arbeit
führt, ist freilich eine weitaus komplexere Frage. Eine lange und verdrängte
Debatte nach dem Zweiten Weltkrieg hat gezeigt, dass die in den obigen Abbildungen
eingezeichneten Arbeitsnachfragefunktionen einen extremen Spezialfall unterstellen.
Um zu solchen schönen Funktio-nen zu kommen, muss die Existenz nur eines
einzigen Kapitalgutes unterstellt werden. In einer Welt mit mehr als einem Kapitalgut
gibt es keine eindeutige Beziehung mehr zwischen Reallöhnen und Arbeitsnachfrage.
Mit steigenden Reallohnsätzen kann die Beschäftigung steigen, mit
fallenden kann sie sinken (14).
Dieser für die simple Neoklassik so unangenehme Effekt hängt wiederum
mit der Existenz von Kreislaufindustrien, also der industriellen Verflechtung
zusammen (vgl. die Argumentation oben). Kommt es zu Veränderungen des Lohnniveaus,
dann werden unterschiedliche Branchen unterschiedlich betroffen. War vor der
Veränderung der Löhne die Profitrate in allen Branchen gleich - ein
Basisannahme jeder theoretischen Volkswirtschaftslehre - , dann ist sie nach
der Veränderung der Löhne nicht mehr gleich, da arbeitsintensive Industrien
beispielsweise von Lohnerhöhungen stärker betroffen werden als kapitalintensive.
Passen sich die Preise in der "ersten" Runde so an, dass die Profitrate
wieder in allen Branchen den gleichen Wert annimmt, dann bedingt dies eine neue
Struktur der relativen Preise. Dies wird bei Unternehmen zur Wahl einer anderen
Technik führen. Da die neuen Preise auch die Preise von Kapitalgütern
verändert haben und Branchen davon unterschiedlich betroffen sind, muss
sich die Struktur der Preise erneut ändern. Es kommt zu einer "zweiten"
Runde, der eine "dritte" folgt etc. Das neue Gleichgewicht wird durch
einen anderen Wert des Kapitalbestandes, eine andere Technik und ein anderes
Beschäftigungsvolumen gekennzeichnet. Die Beschäftigung mag steigen
oder fallen (vgl. Sraffa 1960). Die Zerstörung der für die simple
neoklassische Argumentation so wichtige Nachfragefunktion nach Arbeit kann nur
verhindert werden, wenn die Existenz nur eines Kapitalgutes bzw. einer einzigen
Branche in der Ökonomie unterstellt wird. Der Preis dieser Annahme ist
hoch, da sie Marktprozesse aus dem Modell kippt, die es gerade zu modellieren
gilt.
Wohlgemerkt, diese Erkenntnisse werden nicht durch eine Kritik des neoklassischen
Paradigmas von "außen" abgeleitet, sondern entstammen dem neoklassischen
mikroökonomischen Ansatz in der Tradition von Léon Walras, der gerade
die Überlegenheit des neoklassischen Ansatzes belegen
sol (15). Das Zerbröseln der simplen Nachfragefunktion
nach Arbeit trifft die neoklassischen wirtschaftspolitischen Empfehlungen ins
Mark, da mit dieser Erkenntnis die gesamte Debatte um die Flexibilisierung der
Arbeitmärkte mit dem Ziel der Absenkung des Lohnniveaus obsolet
wird (16).
Der keynesianische Ansatz rückt den Vermögens- und Gütermarkt
ins Zentrum der Analyse und nicht den Arbeitsmarkt. Dadurch ändert sich
der Blickwinkel auf die Ökonomie komplett und damit auch die beschäftigungspolitischen
Konzepte. Besteht das Credo des simplen neoklassischen Ansatzes in der Liberalisierung
des Arbeitsmarktes, dann besteht es im Keynesianismus in der Förderung
der Investitionstätigkeit und der Steigerung der aggregierten Nachfrage.
Denn es ist das Niveau der Nachfrage, was letztlich das Produktionsvolumen bestimmt
(vgl. Keynes 1936).
Investitionen stellen den Motor der Ökonomie dar, da sie die aggregierte
Nachfrage wesentlich determinieren. Investitionen und Produktionsprozesse müssen
in kapitalistischen Ökonomien generell durch Geld finanziert werden, wobei
die Finanzierung der Investition bzw. Produktion vorausgeht. Bei der Finanzierung
wirken mehrere Faktoren zusammen. Zunächst muss die Zentralbank Geld an
die Geschäftsbanken verleihen. Die Banken geben wiederum Kredite an das
Publikum, wobei neben Zentralbankkrediten Depositen des Publikums die zweite
Refinanzierungsquelle der Banken sind. Neben dem Bankensystem können Haushalte
direkt Kredite an den Unternehmenssektor geben oder Aktien kaufen. Schließlich
treten zwischen den Haushalts- und den Unternehmenssektor noch Finanzintermediäre
wie Investmentfonds etc. Zudem können Unternehmen auch mit eigenen Mitteln
(Selbstfinanzierung) Produktionsprozesse durchführen. Wie kompliziert der
Prozess im Einzelnen auch ist, es ergibt sich ein Finanzvolumen, das mit dem
Investitions- und Produktionsvolumen korrespondiert. Unternehmen nutzen die
finanziellen Mittel, um Arbeitskräfte zu mieten und Produktionsmittel zu
kaufen. Indem die Unternehmen die Gütererzeugung organisieren, bewirken
sie zugleich den volkswirtschaftlichen Einkommensbildungsprozess. Mit Hilfe
der geschaffenen Einkommen, die zum größten Teil an die Haushalte
fließen, fragen diese Konsumgüter nach und/oder sparen. Sobald Haushalte
sparen, bauen sie eine Vermögensposition auf. Einkommensbildung, Ersparnisbildung
und Vermögensbildung laufen in einer Ökonomie somit simultan ab (vgl.
Hei-ne/Herr 2001). Märkte sind in aller Regel so über Preis-Mengen-Beziehungen
definiert, dass eine Veränderung der Preise zu einer Veränderung der
nachgefragten und angebotenen Mengen führt. Dieser Mechanismus gilt im
keynesianischen Ansatz für den Arbeitsmarkt aber nicht. Vielmehr bestimmt
der Umfang des Produktionsvolumens - bei gegebener Technik - das Beschäftigungsniveau
(17). Auf dem Arbeitsmarkt reflektieren sich bei der Arbeitsnachfrage
lediglich Entscheidungen, die zuvor auf dem Vermögens- und Gütermarkt
getroffen wurden. Gleichgültig wie die Arbeitsangebotsfunktion im Einzelnen
konstruiert wird, auf dem Arbeitsmarkt ist ein Vollbeschäftigungsgleichgewicht
ein unwahrscheinlicher Zufall. Insofern sind keynesianische Vorstellungen durch
eine Hierarchie der Märkte geprägt, wobei der Vermögensmarkt
dominiert und der Arbeitsmarkt der dominierte Markt ist, der von sich aus die
Beschäftigung nicht erhöhen kann.
Veränderungen der Löhne können nach keynesianischer Ansicht keine
Vollbeschäftigung herstellen. Die Lohnkosten gehen vielmehr als Kostenfaktor
in die Preise der erstellten Güter ein und sind der wichtigste Faktor zu
Bestimmung des Preisniveaus (vgl. Keynes 1930; Riese 2001, Heine/Herr 2002).
Dann führen Lohnsenkungen ebenso wenig wie eine Senkung der Lohnnebenkosten
zu mehr Beschäftigung, sondern ceteris paribus zu sinkenden Preisen. Die
Lohnentwicklung kann auch die Verteilung zwischen Lohn und Profit nicht ändern,
da beispielsweise Lohnerhöhungen letztlich immer auf die Preise überwälzt
werden. Allerdings bestimmen Lohnverhandlungen die Struktur der Löhne:
"Mit anderen Worten, der Kampf um die Geldlöhne beeinflusst in erster
Linie die Verteilung der Summe der Reallöhne zwischen den verschiednen
Arbeitnehmergruppen und nicht deren Durchschnittsbetrag je Beschäftigungseinheit...
Die Vereinigung einer Gruppe von Arbeitern bewirkt den Schutz des verhältnismäßigen
Reallohnes. Das allgemeine Niveau der Reallöhne hängt von den anderen
Kräften der Wirtschaftsordnung ab (18)."(Keynes
1936: 12)
Der Arbeitsmarkt hat gleichwohl nach keynesianischen Vorstellungen eine wichtige
Funktion. Bei Berücksichtigung von Produktivitätsentwicklungen wird
eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik zum nominellen Anker des Preisniveaus.
Beträgt die Zielinflationsrate beispielsweise 1,5% und die Produktivitätserhöhung
2%, dann erhöhen sich Lohnstückkosten und Preisniveau in etwa entsprechend
der Zielinflationsrate, wenn die nominellen Bruttolöhne um 3,5%
steigen (19). Ein funktionierender Lohnanker ist für
die ökonomische Entwicklung eines Landes von großer Bedeutung. Liegen
Lohnerhöhungen deutlich über der Produktivitätsentwicklung, dann
kommt es zu inflationären Prozessen, welche die Zentralbank früher
oder später mit steigenden Zinssätzen mit dem Resultat sinkender Investitionen
und steigender Arbeitslosigkeit bekämpft. Liegen die Lohnerhöhungen
unter der Produktivitätsentwicklung oder sinken die Löhne gar, ergeben
sich deflationäre Entwicklungen. Deflationen führen zur Erhöhung
der realen Schuldenlast der Unternehmen, da Umsatzerlöse nominal sinken
und der Schuldendienst unverändert bleibt. Bei der Erwartung sinkender
Preise werden zudem Investitions- und Konsumentscheidungen in die Zukunft verschoben.
Deflationen führen ab einer gewissen Intensität mit großer Gewissheit
in eine ökonomische Katastrophe. Da die Geldpolitik bei der üblicherweise
geringen Zinselastizität der Investitionen in einer Krise eine schwache
Stellung zur Bekämpfung von Deflationen einnimmt, wird gerade in einer
tiefen und anhaltenden Krise der nominelle Lohnanker von existentieller Bedeutung.
Vor dem Hintergrund der keynesianischen Analyse des Arbeitsmarktes bergen die
Hartz-Vorschläge die Gefahr in sich, zu einer deflationären Entwicklung
beizutragen. Zwar setzt der Hartz-Ansatz nicht explizit auf eine generelle Lohnsenkung,
jedoch sehr deutlich auf eine größere Lohnspreizung und den Aufbau
von Niedriglohnarbeitsplätzen. Die Absenkung der Löhne der Niedrigverdiener
kann jedoch das ganze Lohngefüge in Bewegung bringen und zu deflationären
Tendenzen führen. Verstärkt wird diese Gefahr, da gleichzeitig mit
der Durchführung der Reformen der Hartz-Kommission von Politik und Arbeitgebern
sehr niedrige Lohnerhöhungen gefordert werden und auch "Nullrunden"
ins Gespräch gebracht werden. Sollte sich die Lohnspreizung nach untern
ausweiten und gleichzeitig das allgemeine Lohnniveau sinken, dann wäre
der Weg in die Deflation mit all ihren negativen Effekten vorprogrammiert. Europa
würde dann - geführt durch Deutschland - Japan folgen, das schon seit
einem Jahrzehnt in Stagnation und deflationären Entwicklungen steckt. Angebracht
wären Schritte, den sowieso erodierenden Lohnanker in Deutschland zu festigen.
Die Hartz-Reformen tragen dazu nichts bei (20).
Populär ist die These der Entkopplung zwischen Beschäftigung und Wachstum.
Jedoch gibt es für diese These keine Begründung. Denn es gilt zweifelsfrei,
dass sich die Beschäftigungsentwicklung mittelfristig durch die Wachstumsrate
des Sozialproduktes minus der Produktivitätsentwicklung ergibt. Steigt
die Produktivität beispielsweise um 2%, dann ergeben sich nur dann positive
Beschäftigungseffekte, wenn die Wachstumsrate über 2% liegt. Was die
letzten Jahrzehnte zu beobachten war, war keine Entkopplung von Beschäftigung
und Wachstum, sondern eine langfristige Ab-nahme des prozentualen Wachstums
bei relativ stabiler Produktivitätsentwicklung.
Bei gegebener Bevölkerung und gegebener Erwerbsquote ergeben sich aus keynesianischer
Sicht im Prinzip drei Strategien zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit.
Erstens: Erhöhung der Wachstumsrate deutlich über den Produktivitätsanstieg
hinaus insbesondere durch Stimulierung der Investitionstätigkeit. Rückgrat
einer solchen Strategie ist das funktionale Zusammenwirken zwischen Lohnentwicklung
- in der Tendenz Lohnerhöhungen leicht über der Produktivitätsentwicklung
-, Zentralbank niedrige Zinssätze, wann immer möglich - und öffentlichen
Haushalten - antizyklische Fiskalpolitik und Investitionen in Infrastruktur
und Bildung etc. In der gegenwärtigen Konstellation müsste ein solches
Wachstumsregime in einem europäischen Kontext geschaffen werden. Bisher
fehlen nahezu alle Voraussetzungen für die Schaffung eines solchen Regimes,
da es keine europäische Fiskalpolitik gibt, kein europäischer Lohnbildungsmechanismus
existiert und die Europäische Zentralbank bei ihrer Geldpolitik an alten
Zöpfen festhält (vgl. Heine/Herr 2002a). Ein solches Wachstumsregime
kann hohe Beschäftigung bei vergleichsweise egalitärer Einkommensverteilung
erreichen. Empfehlenswert wäre eine Kommission, die Vorschläge auf
diesem Gebiet entwickelt.
Zweitens: Reduzierung der Arbeitszeiten in Form von längerem Urlaub, Verkürzung
der Wochenarbeitszeit, Weiterbildungsphasen im Berufsleben etc. Dies würde
eine Senkung der realen Lohnsumme der einzelnen Beschäftigten bedeuten,
die dafür mehr Zeit für andere Aktivitäten zur Verfügung
hätten. Denn eine Arbeitszeitverkürzung bei gleicher Lohnsumme pro
Arbeitnehmer würde die Kosten der Unternehmen erhöhen und einen dysfunktionalen
Inflationsschub auslösen. Die reale Lohnsumme pro Beschäftigter würde
auf alle Fälle fallen. Selbstverständlich könnte ein Teil der
jährlichen Produktivitätserhöhung für Arbeitszeitverkürzung
genutzt werden, so dass die realen Lohnsummen auch bei weniger Arbeitsstunden
pro Kopf nicht fallen müssen. Setzt man nicht (allein) auf Wachstum - was
langfristig schon aus ökologischen Gründen schwierig ist -, dann kann
der erste Weg mit dem zweiten kombiniert werden.
Drittens: Senkung der durchschnittlichen Produktivität in der Ökonomie.
Diesen Weg schlägt de facto die Hartz-Kommission vor, die damit dem US-amerikanischen
und britischen Modell folgt. Denn eine stärkere Lohnspreizung in Richtung
von Billigjobs und Förderung von arbeitsintensiven Beschäftigungsverhältnissen
mit geringen Qualifikationsanforderungen in Einbahnindustrien wie persönlichen
Dienstleitungen in Privathaushalten senkt künstlich die durchschnittliche
Produktivität. Eine langfristig überzeugende Entwicklungsperspektive
für eine Gesellschaft ist dies weder ökonomisch noch politisch. In
diesem Sinne ist die Philosophie, die hinter den Harz-Vorschlägen steckt,
abzulehnen. Davon unberührt bleibt, dass bessere Vermittlungsbemühungen
der Bundesanstalt für Arbeit, Förderung von Selbständigkeit oder
ähnliche Elemente der Harz-Vorschläge unterstützenswert sind.
PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 129, 32. Jg., 2002, Nr. 4, Hansjörg Herr
In die verdeckte Arbeitslosigkeit gehen ein: das Arbeitslosenäquivalent der Kurzarbeit, Personen in beschäftigungsschaffenden Maßnahmen, Personen in beruflicher Weiterbildung und Empfänger von vorzeitiger Altersrente (vgl. Sachverständigenrat 2002). zurück
Die Lohnstruktur sowie vielfältige Formen der sozialen Absicherung können über ihre Wirkung auf die Motivation der Arbeitnehmer die Arbeitsproduktivität verändern. So arbeitet ein sozial abgesicherter Arbeitnehmer vermutlich motivierter als ein Arbeitnehmer, der nicht abgesichert ist. Auch können Institutionalisierungen, welche die Kosten erhöhen - etwa längerer Urlaub oder aufwendige Unfallschutzmaßnahmen - die Produktivität so erhöhen, dass die Lohnstückkosten sinken. Auf diese Aspekte wird in diesem Beitrag aber nicht eingegangen. zurück
Zusammen mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Kosten für Beschäftigte in privaten Haushalten soll diese Regelung zu einer Verringerung der Schwarzarbeit führen. zurück
Zu den Details vgl. Bundesanstalt für Arbeit (2002). zurück
Im September 1999 waren 621.467 Personen ein Jahr bis unter 2 Jahre arbeitslos (15,8% der Arbeitslosen) und 1.378.696 Personen länger als ein Jahr (35% der Arbeitslosen), vgl. Bundesanstalt für Arbeit (2002). zurück
Es handelt sich um die von Sraffa (1960) untersuchte Ökonomie. Sraffa arbeitete heraus, dass sich makroökonomisch die Zinsrate (Profitrate) ergibt, wenn die Löhne vorgegeben werden. Wird die Zinsrate vorgegeben, resultiert der Lohnsatz als Restgröße (vgl. dazu auch Heine/Herr 2002). zurück
Diesen Schluss kann man sowohl auf der Grundlage von Sraffa (1960) ziehen als auch aus dem mikroökonomischen Totalmodell in der Tradition von Walras, dem Begründer der neoklassischen Mikroökonomie (vgl. Heine/Herr 2002). zurück
Klarer äußert sich der Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik in Köln: "Könnte dieser Prozess (der Lohnsenkung, d. V.) nicht auch in Gang gesetzt werden, wenn man den Arbeitslosen ermöglichte, freie Arbeitsverträge zu vereinbaren? Ohne Zweifel wäre dies ein marktkonformer und vergleichsweise schneller Weg zu mehr Beschäftigung. Man muss aber daran denken, dass ein erhebliches Defizit an Arbeitsplätzen besteht. Ein abrupter Übergang zu Marktlöhnen würde möglicherweise sehr starke, wenn auch vorübergehende Lohnsenkungen auslösen, weil die Unternehmen Zeit brauchen, zusätzliche produktive Arbeitsplätze zu schaffen" (Eekhoff 2002). zurück
Hinter der Nachfragefunktion nach Arbeit stehen eine Reihe problematischer Annahmen. Unterstellt wird eine makroökonomische Produktionsfunktion, also eine Produktionsfunktion, welche die unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Branchen zu einer Fabrik zusammenschmelzt. Dies geht nur, wenn ausschließlich ein Kapitalgut existiert. Unterstellt werden zudem konstante Skalenerträge, die zum Ausdruck bringen, dass unabhängig vom schon realisierten Produktionsvolumen jede weitere Erhöhung aller Inputfaktoren mit einem konstanten Faktor die Produktionsmenge proportionale steigen lässt. Diese Annahme garantiert ein fallendes physisches Grenzprodukte des Faktors Arbeit. Diese Grenzertragskurve ist mit der Nachfrage nach Arbeit identisch, denn die Unternehmen maximieren den Arbeitseinsatz immer dann, wenn das Grenzprodukt der Arbeit dem Reallohnsatz entspricht (vgl. zur genaueren Ableitung Heine/Herr 2002). zurück
Es muss betont werden, dass viele Neoklassiker die Notwendigkeit der Mikrofundierung makroökonomischer Funktionen in den Vordergrund rücken. Eine strikte Mikrofundierung der Makroökonomie ist jedoch nicht zu leisten. Ein Beispiel ist die aggregierte Angebotsfunktion auf dem Arbeitsmarkt, die rein verhaltenstheoretisch ableitbar ist und damit von historischen und kulturellen Faktoren abhängt (vgl. Stiglitz 1992; Heine/Herr 1998). zurück
Für das mikroökonomische neoklassische Gleichgewichtsmodell sind mehr als eine Gleichgewichtslösung keineswegs un-gewöhnlich, sondern entsprechen dem allgemeinen Fall. zurück
Mit dem neoklassischen Wohlfahrtskriterium (Pareto-Kriterium) lässt sich nicht entscheiden, welches Gleichgewicht besser ist, da ein individueller Nutzenvergleich nicht möglich ist und die drei Gleichgewichte den einzelnen Wirtschaftssubjekten subjektiv unterschiedliche Nutzen liefern. Nur eine politische Entscheidung ist in der Lage, eine Hierarchie der verschiedenen Gleichgewichtspunkte zu geben. zurück
Ein weiteres Problem taucht auf. Befindet sich die Ökonomie in einem Ungleichgewicht, dann kann die partielle Betrachtung des Arbeitsmarktes zu falschen Schlussfolgerungen führen. Es kann dann relativ einfach gezeigt werden, dass eine Lohnsenkung, die aus der partiellen Analyse des Arbeitsmarktes als sinnvoll erscheint, bei der simultanen Betrachtung aller Märkte falsch ist. Eine Lohnsenkung würde das Ungleichgewicht in der Ökonomie noch verschärfen. (Ein einfaches Zah-lenbeispiel für diesen Fall findet sich in Heine/Herr 2002, Kapitel 2). zurück
Auch der eindeutige Zusammenhang zwischen Kapitalintensität und Zinssatz, der in der simplen Variante der neoklassischen Theorie unterstellt wird, gilt bei mehr als einem Kapitalgut nicht mehr. zurück
Verdeutlicht wird die Argumentation beispielsweise von Bliss (1975), jedoch auch von Samuelson (1966), der sich lange gegen die Zerstörung der simplen neoklassischen "Parabeln" wie der wohlgeformten Nachfragefunktion nach Arbeit gewehrt hat. zurück
Es sei angemerkt, dass in einer Welt mit nur einem Kapitalgut auch Karl Marx eine konsistente Wert- und Preistheorie lie-fern kann, da es dann das sogenannte Transformationsproblem von Arbeitswerten in Preise nicht gibt. zurück
Auch hier muss akzeptiert werden, dass jeder Veränderung der Verteilung zu einer neuren Technikwahl führt, die sich nicht prognostizieren lässt. zurück
Die Verteilung wird im keynesianischen Ansatz wesentlich durch den Zinssatz bestimmt, der sich auf dem Vermögensmarkt ergibt. Reallöhne sind dann die resultierenden Größen. zurück
Die Europäische Zentralbank hat eine Zielinflationsrate zwischen 0-2%. Die Produktivitätsentwicklung lag in Deutschland während der letzten Jahre um die 2,5%. zurück
In Japan steigen die Geldlöhne weniger als die Produktivität, da die Arbeitnehmer bei ihren Lohnforderungen äußerst zurückhaltend sind - seit einem Jahrzehnt ohne Erfolg! Das japanische Tarifvertragswesen fördert deflationäre Entwicklungen, da Lohnverhandlungen auf Betriebsebene abgeschlossen werden und die Arbeitnehmer üben Lohnverzicht, um "ihren" Betrieb in einer schwierigen Lage zu stützen. Tun dies alle, dann nützt dies keinem. Im Gegenteil, es entsteht eine deflationäre Entwicklung. zurück
Litaratur
Blanchard, O. (1987): Hysteresis in Unemployment. In: European Economic Review,
Vol. 31
Eekhoff, J. (2002): Stoppt das Tarifmodell. Handelsblatt vom 5.9.02.
Flassbeck Bliss, C.J. (1975): Capital Theory and the Distribution of Income,
Amsterdam u.a.
Bundesanstalt für Arbeit (2002): www.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/
, H./Spieker, F. (2001): Lohnstruktur und Beschäftigung. Gutachten für
die Otto Brenner Stiftung, Berlin
Hartz-Bericht (2002): Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Bundesministerium
für Arbeit und Sozialord-nung, Berlin, www.bma.de
Heine, M./Herr, H. (2002): Volkswirtschaftslehre. Paradigmenorientierte Einführung
in die Mikro- und Makroöko-nomie, 3. Auflage, München
Heine, M., Herr, H. (2002a): Zwickmühlen der europäischen Geldpolitik:
Muddling Through mit John Maynard Friedman? In: A. Heise (Hrsg.), Neues Geld
- alte Geldpolitik? Die EZB im makroökonomischen Interaktions-raum, Marburg
Heine, M./Herr, H. (2001): Geld, Finanzierung und Einkommensbildung: Eckpunkte
einer monetären Theorie der Produktion. In: U.-P. Reich, C. Stahmer, K.
Voy (Hrsg.), Kategorien der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-gen, Band 3,
Geld und Physis, Marburg
Heine, M./Herr, H. (1999): Die beschäftigungspolitischen Konsequenzen von
"Rot-Grün". PROKLA 116
Heine, M./Herr, H. (1998): Keynesianische Wirtschaftspolitik - Mißverständnisse
und Ansatzpunkte. In: H. Heise (Hrsg.), Renaissance der Makrokönomik, Marburg
Herr, H. (2002): Wages, Employment and Prices. An Analysis of the Relationship
Between Wage Level, Wage Structure, Minimum Wages and Employment and Prices.
In: Working Papers No 15 des Business Institute Berlin an der Fachhochschule
für Wirtschaft Berlin
www.fhw-berlin.de/fhw2000/lehre_und_forschung/working_paper_15.pdf
Keynes, J. M. (1930): Vom Gelde, Berlin
Keynes, J. M. (1936): Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses
und des Geldes, Berlin
Riese, H. (2001): Grundlegungen eines monetären Keynesianismus - ausgewählte
Schriften 1964 - 1999, 2 Bde. Herausgegeben von Betz, K. u.a., Marburg
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
(2002): Jahresgutachten 2001/2002, Berlin
Samuelson, P. (1966): A Summing Up. In: The Quarterly Journal of Economics,
Vol. 80
Sraffa, P. (1960): Warenproduktion mittels Waren, Frankfurt a. M. 1976
Stiglitz, J. E. (1992): Capital Markets and Economic Fluctuations in Capitalist
Economies. In: European Economic Review, Vol. 36