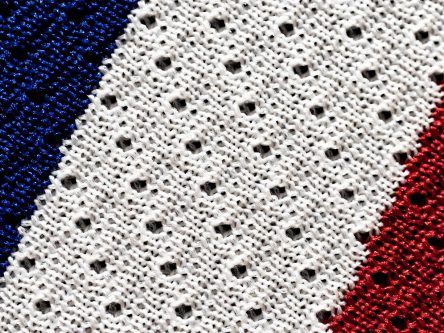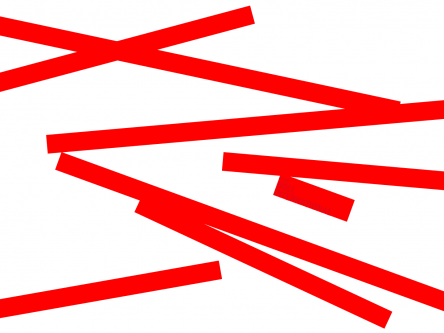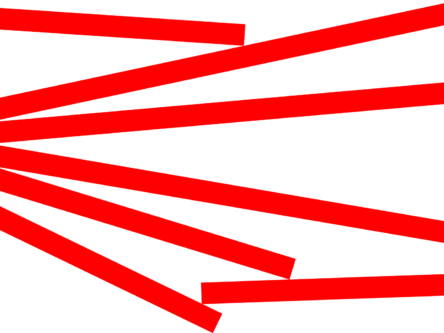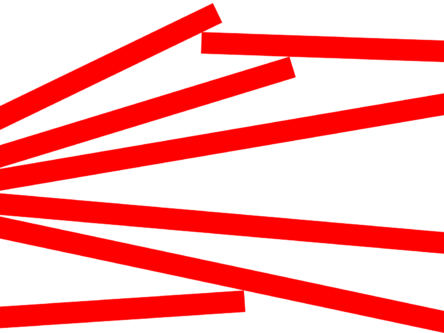Trotz der Präsidentschaft eines rechtspopulistischen PiS-Politikers ist es den Reformpolitiker*innen um Donald Tusk nach dem russländischen Überfall auf die Ukraine gelungen, zu einer maßgeblichen Gestaltungsmacht in der Europäischen Union zu avancieren. Nach der Präsidentschaftswahl im Juni dieses Jahres stellt sich die Situation allerdings anders dar. Der neue Präsident Karol Nawrocki von der PiS wurde mit knapper Mehrheit gewählt und steht ebenso wie sein Vorgänger für die politische Spaltung des Landes. Seine politischen Neigungen scheinen eher Donald Trumps USA zu gelten als der Europäischen Union. Damit könnte Polen zum ungewollten Unterstützer Putins werden, sollte sich die US-Politik unter Trump nicht ändern.
Auch hat der Wahlkampf in Polen gezeigt, dass sich mit antideutschen Ressentiments nach wie vor Wählerstimmen gewinnen lassen. Allerdings hat die Bundesrepublik in Vergangenheit und Gegenwart immer wieder auch Anlässe geboten, diese Stimmung zu befeuern. Das jüngste Beispiel: Der gerade gewählte Kanzler Friedrich Merz kommt zu seinem Antrittsbesuch nach Polen mit gegen Asylsuchende gerichteten Grenzkontrollen, die geltendem EU-Recht widersprechen.
Seit Jahren gelingt es anders als mit Frankreich nicht, zu einer belastbaren Annäherung und Aussöhnung, gar zur Freundschaft zwischen Polen und Deutschland zu kommen. Woran liegt das? Welche konkreten Blockaden und Vorurteile gibt es? Wie lassen sich diese verringern? Was könnte und sollte die deutsche Politik leisten, um angesichts der bedrohlich düsteren Weltlage Europas Einigkeit und Stärke voranzubringen?
Diskussion mit:
Peter Oliver Loew Direktor des Deutschen Polen-Instituts, Darmstadt
Manfred Sapper Chefredakteur der Zeitschrift „Osteuropa“, Berlin
Bruno Schoch Politikwissenschaftler, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF)