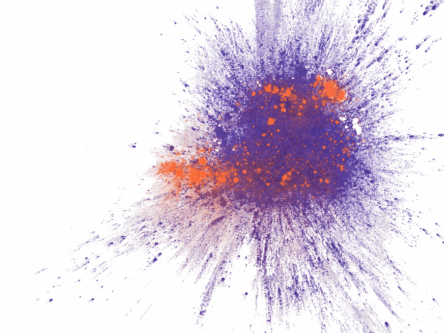Seit Anfang des Jahres geistert der Begriff „Deep State“ – zu deutsch „Tiefer Staat“ oder auch Schattenstruktur – durch die öffentliche Debatte. Rechtspopulist*innen nutzen den Begriff, um Zivilgesellschaft und demokratische Institutionen pauschal und strategisch zu verdächtigen. Die Behauptung: Es gäbe geheime Machtstrukturen, die gegen das Interesse der Allgemeinheit den Staat steuern und mit staatlichen Geldern indirekt Politik betreiben.
In der Vergangenheit ist damit vor allem die rechtsextreme AfD aufgefallen, um so Druck auf zivilgesellschaftliche Institutionen auszuüben. Mittlerweile normalisiert sich die Erzählung über Soziale Medien, Bücher und vermeintliche Dokumentationen.
Auch die CDU/CSU griff dieses Narrativ in einer Kleinen Anfrage im Bundestag im Januar 2025 auf. Es wurde suggeriert, dass 17 zivilgesellschaftliche Organisationen auf unzulässige Weise und mit staatlicher Förderung die politische Willensbildung beeinflussen und parteipolitisch agieren würden.
Viele Akteur*innen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft kritisieren die Anfrage und fordern stattdessen, Zivilgesellschaft zu unterstützen.
Wir möchten bei dieser Veranstaltung zunächst mit einem Input von Lisa Wassermann, Projektleitung des Projekts „Entschwörung lokal“ bei der Amadeu Antonio Stiftung, den Hintergrund und den Stand der Debatte klären.
Im Anschluss stellen wir uns den Angriffen und sprechen mit Lisa Wassermann, Christina Deckwirth von Lobbycontrol und Matthias Laurisch vom NABU über Gegenstrategien. Warum ist Zivilgesellschaft wichtig und warum wird sie staatlich gefördert? Welche Strategien hat Zivilgesellschaft gegen solche Angriffe? Und wie kann Kritik an Strukturen, Sorgen über Interessenskonflikte und berechtigte Forderung nach Transparenz formuliert werden, ohne zu pauschalisieren oder Verschwörungserzählungen zu bedienen?
Die Veranstaltung ist Teil der Online-Reihe Haltung zeigen – Förderung sichern – Zivilgesellschaft verteidigen des Heinrich Böll Stiftungsverbunds. Weitere Informationen und Veranstaltungen finden Sie hier.
Zielgruppe: Fachkräfte der politischen Bildung, Mitarbeitende und Ehrenamtliche aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, pädagogische und beratende Fachkräfte, sowie alle Interessierten, die sich mit Verschwörungserzählungen, demokratiefeindlichen Ideologien und der politischen Instrumentalisierung von Begriffen wie „Deep State“ auseinandersetzen möchten.
Antidiskriminierungsregel Den Veranstaltenden ist ein respektvolles und diskriminierungsfreies Miteinander sehr wichtig. Störungen oder Beleidigungen führen zum Ausschluss aus der Veranstaltung. Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.